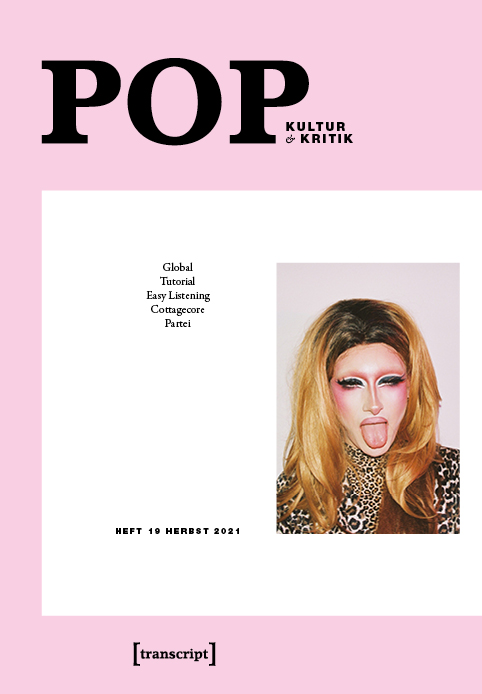Unter Männern
Incels, TFW No GF, Cuck, NoFap, #MGTOW
Was ist schlimmer: Feminismus oder Pornografie? Diese auf den ersten Blick abseitig anmutende Fragestellung wird derzeit in maskulinistischen Internet-Foren diskutiert. Dahinter steckt der Versuch, die verborgenen Mechanismen der Misere zu ergründen, in der deren User sich befinden.
Einsam, hoffnungslos und notgeil.
Nur wenige Jahre nachdem die #metoo-Bewegung den mächtigen Mann-als-Raubtier als Endgegner systemisch gepolsterter Frauenverachtung ausmachte, geistert ein neues cis-männliches Schreckgespenst durchs Feuilleton: der Incel. Das Kofferwort steht kurz für ›involuntary celibate‹, also unfreiwillig zölibatär Lebende. Das trifft auf viele Menschen zu, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der Begriff wurde Ende der 1990er Jahre von einer queeren Kanadierin geprägt, die im Netz eine Supportgruppe für alle gründete, die sich aufgrund diverser sozialer, psychischer oder ästhetischer Ausgrenzungserfahrungen außerstande sahen, ihre sexuellen Bedürfnisse körperlich auszuagieren. Die nachträgliche Verengung des Diskurses auf die Befindlichkeiten heterosexueller Männer und der moralpanische Furor, mit der diese verhandelt werden, belegen zweierlei: Sexuelles Begehren wird in Mainstream-Diskursen immer noch standardmäßig als männlich konnotiert und dabei selbst dann als potenzielle Bedrohung für die Frau verstanden, wenn es nicht ausgelebt wird. »Männer ohne Sex«, küchenpsychologiert die »FAZ«, würden das, was ihnen »von Medien und Gesellschaft versprochen wird« nicht bekommen, was eine »extreme Verletzlichkeit« bis hin zu einer »unüberwindbare Kränkung« zur Folge habe.
Es ist einfach, Incels als digitale »Lolcows« zu nutzen, also ihre bizarren Online-Tiraden für das private Amüsement zu melken, wie es der überaus populäre, inzwischen geschlossene Subreddit »IncelTears« tat. Denn im Gegensatz zu anderen medial ausgeschlachteten Misogynie-Treibern, aktuell z.B. diversen Protagonisten der Deutschrap-Szene, sind sie von ihrer eigenen Herrlichkeit alles andere als überzeugt. Ihr Denken und ihr Selbstbild ist von der Vorstellung übermächtiger evolutionsbiologistischer Marktgesetze geprägt, die sie ans unterste Ende der sexuellen Nahrungskette verweisen. In an Wollust grenzender Selbsterniedrigung posten junge Männer in Unterforen mit Titeln wie »Is it over?« oder »How over is it?« mit der Webcam aufgenommene Porträtaufnahmen, um sich ihr schlechtes Abschneiden in der Gen-Lotterie von Gleichgesinnten empathisch bestätigen zu lassen (»Sorry, dude«). Geradezu besessen sind sie von Ergebnissen der empirischen Attraktivitätsforschung, die eine kantig ausgeprägte Kieferpartie als das Top-Merkmal männlicher sexueller Anziehungskraft ausmachen, weswegen Exemplare mit fliehendem Kinn besonders ausführlich bemitleidet werden. (Die Beauty-Industrie hat darauf bereits reagiert und bewirbt Unterkiefer-Implantate oder -Unterspritzungen mit Hyaluronsäure als »Mascu-Look«.)
Einen sozialphilosophischen Ansatz verfolgte der Dokumentarfilm »TFW No GF« der US-amerikanischen Regisseurin Alex Lee Moyer aus dem Jahr 2020. Das Akronym steht für »That Feel when no Girlfriend« und ist einem in der Szene ikonischen Mem entlehnt, das eine als »Wojak« bezeichnete Figur zeigt. Die krude Zeichnung eines glatzköpfigen jungen Mannes mit unbeteiligtem Gesichtsausdruck tauchte um 2010 auf dem deutschen Imagebord »Krautchan« auf. Kurz darauf machte ein Mem die Runde, auf dem zwei Wojaks sich unter der Überschrift »I know that feel, bro« umarmen. Moyers Film ist schon deswegen sehenswert, weil er den Versuch unternimmt, die Netzsphäre, in denen die Protagonisten den Großteil ihrer Zeit verbringen, als grellen visuell-emotionalen Echoraum fassbar zu machen, der die Tristesse spätkapitalistisch zersiedelter Landschaften konterkariert. Man kommt nicht umhin, Mitleid mit den blassen, schlecht rasierten jungen Männern zu empfinden, die die Hoffnung auf ein würdevolles Leben längst aufgegeben haben und so etwas wie Anerkennung nur dann erfahren, wenn es ihnen mal wieder gelungen ist, einen besonders verabscheuungswürdigen Post abzusetzen. Über real existierende Frauen wird in der Doku wenig geredet, sie könnten genauso gut auf einem anderen Stern leben, so wenig buchstäbliche Berührungspunkte gibt es. Der Glaube an das Zustandekommen einer sexuellen Beziehung mit einer Frau scheint so abstrakt wie der an eine göttliche Erlösung. Incels sind Liebes-Atheisten. Es ist beinahe rührend mitanzusehen, wie sie der Regisseurin Moyer, die auch die Interviews geführt hat, kaum in die Augen sehen können und dabei darüber sprechen, dass sie seit frühester Jugend täglich »extreme« Pornografie konsumierten. Immer wieder werden Meme eingeblendet, welche die gefühlsmäßigen Verheerungen, die dieser Lebensstil in ihnen auslöst, bebildern sollen. Wojak wütet, Wojak weint.
Moyer, die bewusst darauf verzichtet, die Aussagen ihrer Protagonisten mittels Audiokommentar zu bewerten, musste nach dem Start des Films in den USA viel Kritik einstecken. Man warf ihr zu Recht vor, die hasserfüllten Online-Personas vorschnell mit dem Verweis auf ihre gesellschaftliche Benachteiligung (wobei nicht ganz klar ist, worin diese genau besteht) zu entschuldigen oder sogar als avantgardistische Form der Gesellschaftskritik zu interpretieren. Auf besonderes Missfallen stieß eine Szene, in der Moyer es dem berüchtigten Twitter-Troll »Kantbot« gestattete, sich als zerzaustes Knuddelbärchen zu inszenieren, dem eine Freundin aus Fleisch und Blut gewiss nicht nur die Misogynie, sondern auch Rassismus, Antisemitismus und die glühende Trump-Verehrung austreiben würde.
Tatsächlich ist die Idee einer sexuellen Ökonomie zum Nachteil weißer Männer keine Erfindung der Incel-Kultur, sondern wurde mit Michel Houellebecqs Debütroman »Ausweitung der Kampfzone« bereits Ende der 1990er Jahre in die Hochkultur, nun ja, eingeführt. Der Protagonist hasst Frauen und Migranten, weil diese es lieber miteinander treiben würden als mit ihm. Ein Lustmord/Racheakt wird am Romanende nur knapp verhindert. Die »FAZ« lobte damals: »[Houellebecqs] Figuren sind immun gegen jedes Gefühl von Selbstverwirklichung und Erlebnisintensität. Sie kämpfen kommentarlos in reiner Vergeblichkeit, das ist ihre Größe.«
Im Real Life wurde unterdessen aufgerüstet: 2014 tötete der 22jähre selbst-identifizierte Incel Elliot Rodgers in Kalifornien sechs Menschen und verletzte vierzehn weitere. In der Szene gilt er seither einigen als Märtyrer, und die Phrase »going E.R.‹ wird für ausufernde Bestrafungsfantasien verwendet.
Prominentester deutsche Incel ist Stephan Balliet, der im Oktober 2019 in Halle zwei Menschen tötete. Die »Emma« zitiert Balliet, der eigentlich ein viel größeres Massaker hatte anrichten wollen, falsch: er habe sich in seinem die Taten begleitenden, selbst aufgezeichneten Livestream als »Niete« bezeichnet, weil es ihm nicht gelang, in sein eigentliches Anschlagsziel, eine Synagoge, vorzudringen. Tatsächlich benutzte Balliet den ähnlich klingenden Incel-Spezialbegriff »NEET«, der ›not in employment, education or training‹ bedeutet: »Nischt kann ich, Mann.« Die Szene verfügt über einen ganzen Katalog solcher Fachausdrücke, die wiederum lustig wären, wären sie nicht so traurig. Frauen werden als ›foids‹ bezeichnet, eine Abkürzung für Feminoide, weil sie wie Humanoide zwar aussähen wie Menschen, aber in einem essentiellen Sinn keine seien.
Die US-amerikanische Autorin Angela Nagle räumt in ihrem 2017 erschienenen Rechtspopulismus-Sachbuch »Kill All Normies« höchst verständnisvoll sogar ein, Feminist:innen wie sie selbst trügen eine Art Teilschuld an solchen Phänomenen: Zu lange hätte die Bewegung sich den Bedürfnissen von Cis-Männern gegenüber »intolerant und dogmatisch« verhalten und alarmierende Entwicklungen wie das Schulversagen und die hohe Suizidrate unter jungen Männern vernachlässigt. Traditionell erblickt die Männerbewegung im Feminismus hingegen ungerührt das Erzübel der erlittenen Demütigungen.
Ihren strengsten Gegnern wiederum gilt schlichtweg jede Mainstream-Pornografie als radikal anti-feministischer Gegenentwurf, als imaginäres Spielfeld, auf dem Frauen zur Aufwertung des gekränkten Männeregos systematisch objektifiziert und erniedrigt würden. Andrea Dworkin, die man getrost als ›Schwanz-ab-Feministin‹ bezeichnen darf, begriff in ihrem Buch »Pornographie« (1981) selbige als Blaupause der patriarchalen Matrix: »Mutter sein bedeutet: gefickt zu werden; Vater sein bedeutet: selbst ficken. Der Knabe hat die Wahl. Der Knabe entscheidet sich für den Mann, weil es besser ist, ein Mann zu sein als eine Frau.« Vierzig Jahre später fällt dem Knaben die Entscheidung deutlich schwerer. Denn trotz des in der Netzkultur überreichlich vorhandenen Anschauungsmaterials scheint nicht mehr klar zu sein, wer fickt, wer gefickt wird und wer einfach nur dabei zuschauen muss.
Das Wort ›cuckold‹ bezeichnet eigentlich den gehörnten Ehemann, ist aber auch eine Porno-Kategorie für Videos, in denen eine Frau ihren Mann vor dessen Augen betrügt. Im Incel-Weltbild ist ›cuckolding‹ die einzig realistisch vorstellbare Beziehungsform. Nämlich dann, wenn eine in ihrer Jugend von Alpha-Männern emotional sowie körperlich verbrauchte Frau sich auf eine Versorgungsehe mit einem minderwertigen Exemplar wie ihnen einlässt, im Fachjargon als ›Beta-Cucking‹ bezeichnet. »Cuck« ist auch der Titel eines weitgehend übersehenen Incel-Thrillers aus dem Jahr 2019. Im Unterschied zu dem vom Feuilleton als Incel-Film rezipierten »Joker« aus demselben Jahr fokussiert »Cuck« weniger auf allgemeine Ungerechtigkeiten, die dem Protagonisten widerfahren, als auf die Erzähl- und Erlebnislogik der digitalen Pornoindustrie.
Eine Studie im »Journal of Clinical Medicine« aus dem Jahr 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass in den westlichen Industrienationen fünf Prozent der Männer von »Online Porn Addiction« betroffen seien, wenn man als Grenzwert einen wöchentlicher Porno-Konsum von mindestens zwölf Stunden ansetzt. Die Einsicht, dass dieses Verhalten möglicherweise nicht Symptom, sondern Ursache ihres miserablen Sexual- sowie sonstigen Soziallebens darstellt, sickert langsam auch in maskulinistische Kreise durch. Eine erste, aus der Szene geborene Online-Selbsthilfegruppe entstand schon 2012 als Subreddit unter dem Namen »NoFap«. Der lautmalerische Begriff ›fapping‹ ist Internet-Slang für ›Masturbation‹.
Aufgrund der großen Nachfrage wurde zwei Jahre später die Website »NoFap.com« gegründet, die Depressionen, Schamgefühle und ein niedriges Selbstwertgefühl als Folgen übermäßigen Pornokonsums auflistet. Die Nutzer, fast ausschließlich Männer, bestärken sich gegenseitig darin, für eine gewisse Zeit auf »PMO« (Pornografie, Masturbation, Orgasmus) zu verzichten. Selbst einige Alt-Right-Gruppen, etwa die ultra-chauvinistischen Proud Boys, adaptieren das Konzept unter dem Vorwand, dadurch ihre Testosteron-Level in schwindelerregende Höhen zu treiben. Letztendlich bleibt der Zweck jedoch derselbe: Pornoverzicht als Self-Care-Maßnahme für entfremdete Männer.
Den vielleicht konsequentesten Weg schlagen dabei die Anhänger der #MGTOW-Bewegung ein, was für ›men going their own way‹ steht. Sie erblicken in der Pornografie nicht nur ein destruktives Werkzeug, das ersonnen wurde, um ihre Virilität zu schwächen, sondern auch die letzte Hürde, die es zu überwinden gilt, um sich ganz freizumachen von der Unterdrückung durch die verhassten ›foids‹. In einem Vierstufenplan wollen sie sich gänzlich von der sexuellen Ökonomie lösen. Dieser reicht von der Ablehnung romantischer Beziehungen (Stufe Eins) über den kompletten Verzicht auf sexuelle Begegnungen (Stufe Zwei) bis hin zum völligen Rückzug aus der Gesellschaft oder »going ghost« (letzte Stufe). Wie man unschwer an der Veröffentlichung des Plans erkennen kann, sind sie von dieser letzten Stufe aber noch sehr weit entfernt.
Erschienen in POP Kultur & Kritik, Heft 19, Herbst 2021